Es ist das auf „Wachstum" basierende Modell des Industriekapitalismus, das die Hauptantriebskraft für die Produktion überflüssiger Güter ist. Die industrielle Produktion von überflüssigen Gütern ist der Kern der heute vorherrschenden Ideologie des Massenkonsums. Das schreibt Robin Monotti Graziadei.
Er fährt sinngemäß fort: Das Umweltproblem, das sich daraus ergibt, besteht darin, dass es nicht genügend Ressourcen und nicht genügend Natur gibt, um ein solches wachstumsbasiertes industrielles Kapitalismusmodell zu verfolgen und gleichzeitig die Ökologie des Planeten zu retten. Der industrielle Kapitalismus ist mit der Massenproduktion überflüssiger Güter und der Ideologie des Massenkonsums untrennbar verflochten.
Die auf Wachstum ausgerichtete Industrie strebt weltweit nach wirtschaftlichen Gewinnen, und dieses Modell ist es, das letztlich den Planeten auf globaler Ebene ökologisch ausbeutet und wirtschaftlich nur die Industriellen und ihre Aktionäre bereichert, während alle anderen verarmen.
Es liegt auf der Hand, dass das industriebasierte Modell des Wirtschaftswachstums verschwinden muss, um den Planeten zu retten. Industrielle und Finanziers sind sich dessen sehr wohl bewusst, aber sie stellen das Problem wieder einmal auf den Kopf.
Industrielle und Finanziers haben die ökologische Besorgnis der Massen in eine Marketingkampagne für industriell erzeugte erneuerbare Energien verwandelt. Damit versuchen sie, ihre eigenen Profite zu retten, nicht den Planeten. Sie versuchen, das auf „Wachstum" basierende Modell des Industriekapitalismus zu retten, nicht die Ökologie.
Deshalb geben Industrielle und Finanziers der industriellen erneuerbaren Energie ein menschliches Antlitz. Sie haben ihre alten Tricks auf Lager und müssen als die Betrüger entlarvt werden, die sie sind und schon immer waren.
Das menschliche Gesicht der „grünen" erneuerbaren Industrieenergie ist ein Betrug, wenn es sich nicht vom wachstumsbasierten Modell des Industriekapitalismus löst. Jede Form von Energie, auch erneuerbare Energie, die in industriellem Maßstab eingesetzt wird, um ein „wachstumsbasiertes" Modell des Industriekapitalismus zu versorgen, wird letztendlich die Ökologie des Planeten zerstören.
Gleichzeitig muss eine Antikriegsposition eingenommen werden: Neokolonialistische Kriege der Konzerne um Ressourcen sind das direkte Ergebnis des ungebremsten wachstumsbasierten Kapitalismus. Die Lieferketten der erneuerbaren Energie im industriellen Maßstab bedeuten viel mehr Kriege in mineralienreichen Regionen wie dem Kongo und anderen Regionen Afrikas bedeuten.
Die gesamte Gesellschaft der ersten Welt muss als erste zu einer Wirtschaft der Selbstversorgung übergehen, in der man nur das isst und verbraucht, was man wirklich braucht. Dies muss außerhalb der Logik des vom industriellen Kapitalismus geförderten Konsumverhaltens geschehen. Hin zur Produktion für die Selbstversorgung, um auf lokaler Ebene überleben, nicht um auf globaler Ebene verkaufen.
John Maynard Keynes (Nationale Selbstgenügsamkeit, 1933): „Ideen, Wissen, Kunst, Gastfreundschaft, Reisen – das sind die Dinge, die ihrer Natur nach international sein sollten. Aber lasst die Waren, wann immer es vernünftig und bequem möglich ist, selbst hergestellt werden; und vor allem sollten die Finanzen in erster Linie national sein.“
[Nach „Green Autarky: Self Sufficiency Against the Growth Based Model of Industrial Capitalism“]
Das könnte Sie auch interessieren:
- Energiepolitik – Ampel wünscht sich andere Realität vom 06.12.2023
- Elektromobilität – die (nicht nur) norwegische Illusion vom 30.03.2024
- Strompreise – nur eine Richtung. Warum? vom 02.02.2024

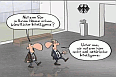

Das ist die Sichtweise eines in der übersättigten Wohlstandsgesellschaft lebenden Menschen.
Die Analyse der Zerstörungskraft der herrschenden ökonomischen Triebkräfte ist unstrittig richtig. Gleichwohl leben 50% der Menschen in jämmerlichem Elend und können und wollenl nicht auf Verbesserung verzichten.
Die Aufgabe der Schrumpfung bei geichzeitiger Egalisierung des Wohstandsgefälles ist eine Herkulesaufgabe primär politischer Art. Aufgeben aber ist keine Alternative.
Kein Kapitalismus ist dabei auch keine Alternative
Vielen Dank für Ihren Beitrag!
Wenn es stimmt, dass dem Kapitalismus die Tendenz innewohnt zu immer größerer (Kapital-)Konzentration, dann folgt daraus über ein paar Ecken die Beherrschung der Politik. Dann wäre er letztlich keine Alternative, weil immer wieder genau das rauskommt, was der Verfasser kritisiert, das auf „Wachstum" basierende Modell des Industriekapitalismus.
Wäre das ordnungspolitische Modell der Freiburger Schule eine Alternative? Die Ordoliberaliberalen lehnen die reine Marktwirtschaft (Kapitalismus) als Wirtschaftsordnung ebenso ab wie die Zentralverwaltungswirtschaft. Ihr Konzept ist die soziale Marktwirtschaft. Würde das funktionieren auch außerhalb der besonderen Situation nach dem zweiten Weltkrieg?
In dem Zusammenhang finde ich diesen Eintrag bei Gabler interessant.
Zunächst sollte man festlegen, was man unter Wachstum versteht. Wenn man auf das BIP zurückgreift (Summe der Waren und Dienstleistungen) könnte man schon ein umweltschonendes Wachstum erzielen, indem am sich auf die Dienstleistungen
konzentriert (Bildung, med Versorgung, Kultur…..) . Ob damit eine Gesllschaft aufrecht zuerhalten ist, ist aber aus meiner Sicht fraglich. (Gegenseitiges Haare schneiden.)
"Industrielle und Finanziers haben die ökologische Besorgnis der Massen in eine Marketingkampagne für industriell erzeugte erneuerbare Energien verwandelt."
Dem kann ich voll zustimmen. Solche "Propagandaslogens" gab es ja schon immer: In den kirchlich geprägten Gesellschaften das Paradies, im Sozialismus
"Der Kommunismus unsere lichte Zukunft" vorher "Lebensraum im Osten" und jetz eben die "Erneuerbaren" verbunden mit der Drohung "Klimakatastrophe".
Im Grunde wollte man damit in den jeweiligen Zeiten immer das Selbe verdecken: die Machtverhältnisse und die Verteilungsverhältnisse.
Die heute auch von Herrn Hering ins Spiel gebrachte Schrumpfung ist sicher keine Lösung. 1. Waren egalitäre Verzichtsgesellschaften meines Wissens nach nie wirklich erfolgreich (z.B. DDR). Sie funktionieren nur eine Zeitlang, wenn sie abgeschottet sind und werden dann von den Geselschaften, die sich nicht an die Schrumpfung halten einfach weggespült. (DDR und aktuell der Westen)
2. Gilt ja das egalitäre Verzichtsgebot natürlich nicht für die Eliten(wirtsch./ pol/ künstler., sport……), die weiter mit ihren Privatjets, Jachten etc. durch die Welt brausen und Champus schlürfen und natürlich russischen!!! Kaviar essen. Das fällt dann irgendwann auch den Dümmsten auf und erzeugt Gegenbewegungen.
Deutschland ist auch noch ein Sonderfall: Früher eine Wegwerfgesellschaft, heute eine Turbowegwerfgesellschaft: Immer häufiger müssen durch staatliche Anordnungen Produkte, die noch lange genutzt werden könnten, weggeworfen bzw. ersetzt werden: Glühlampen, Heizungen, Autos, Kohlekraftwerke /Atomkraftwerke….. Niemand kümmert sich um die wirtschaftlichen Schäden, die
dadurch entstehen, aber ein großer Teil der erzwungenen Ausgaben landen über kurz oder lang auf immer wieder den gleichen Konten.
"Es liegt auf der Hand, dass das industriebasierte Modell des Wirtschaftswachstums verschwinden muss, um den Planeten zu retten."
Das ist mMn Greta Niveau: Den Planeten retten kann niemand das ist auch gar nicht nötig. Gemeint ist vielleicht die menschliche Gesellschafft. Kommt mir so vor, dass der Autor nicht genug zu sagen hat, deshalb bläst er seine Aussage auf:
als nächstes kommt dann die Rettung des Sonnensystems dannach des Weltalls.
Auch wenn mann nun von Rettung der Menschheit ausgeht und das industriebasierte Modell abschafft, was soll es ersetzen??? Gegenseitig die Haare schneiden etc ist wohl eher keine Lösung.
Eine gleichmäßige Verteilung von weniger Gütern widerspricht der menschlichen Natur und würde eine strenge Überwachung und Kontrolle a la WEF-Vorstellungen notwendig machen.
In der DDR konnte man beobachten, dass die Menschen auch auf niedrigem Niveau der Güterversorgung stark danach gestrebt haben sich von anderen abzusetzen, auch wenn es aus heutiger Sicht absolut lächerlich war. (z.B.Unterschied Trabant / Trabant de luxe… bitte gerne mal googlen)
Das ordoliberale Wirtschafftsmodell wird bei Hermann Ploppa "Die Macher hinter den Kulissen" als Sonderfall dargestellt. Das es in der BRD eine zeitlang das Wirtschaftsmodell wurde, bringt er (soweit ich mich erinnere) in den Zusammenhang mit dem Zusammenbruch nach der Nazizeit und der Schaufensterfunktion der BRD gegenüber dem Osten. Jedenfalls ist nach meinem Empfinden nach der Wende nur wenig von der sozialen Marktwirtschaft übrig geblieben. Im Prinzip sind wir da wieder bei der Verteilungsfrage.
Und W.Buffet ist ja der Meinung, dass Krieg herrscht und seine Klasse gewinnt.
Dieses Modell könnte funktionieren, aber es müßte eine Bereitschafft der ganz wenigen Superreichen dazu vorhanden sein. Die sehe ich nicht – ganz im Gegenteil. Abgesehen davon, dass der Anteil der Psychopaten in dieser Bevölkerungsgruppe mMn recht hoch ist.
Danke für Ihren Beitrag! Ein paar Anmerkungen:
Dienstleistungen setzen immer eine materielle Basis voraus, d.h. ohne die Produktion von Dingen gibt es auch keine Dienstleistung. Siehe Ihr Beispiel – zum Haareschneiden braucht man eine Schere.
Egalitäre Verzichtgesellschaften – ja, ich denke auch, die funktionieren zeitweilig nur unter besonderen äußeren Bedingungen.
Aus dem Kontext des Artikels geht meiner Meinung nach hervor, dass der Autor die Menschheit meint. Um den Planeten und die Natur braucht man sich wahrlich keine Sorgen machen. Das funktioniert auch ohne den Menschen.
Mit der Superwegwerfgesellschaft haben Sie absolut recht. Daher hatte ich ja auch schon mehrfach geschrieben, dass der Übergang zur Dekarbonisierung der Energierzeugung den Ressourcenverbrauch erst so richtig anheizt.
H. P. Dürr hat mal die These aufgestellt, dass auf lange Sicht streng genommen alles, was über die Nutzung der Syntropie der Sonne hinausgeht, das Ökosystem zusätzlich gefährdet. Die täglich von der Sonne eingestrahlte Energie liegt seiner Rechnung zufolge bei 178.000 Terawatt. Auf die Erdoberfläche fällt ein Äquivalent von 1.000 Liter Erdöl pro Jahr und qm. Nach Dürrs Ansicht müssen wir auf den Lebensstandard eines Schweizers Ende Ende der 1960er Jahre zurück (Energieverbrauch pro Mensch 2,76 kW). Das tägliche Minimum zum Überleben sieht er bei 1,34 kW. (Ich werde das noch genauer ausführen.)
Das ordoliberale Modell – Sie haben recht. Das gedieh unter den besonderen Umständen der Nachkriegszeit und wurde mit dem Ende des Regimes von Bretton Woods nach und nach abgeschafft. Um der Willkür des internationalen Kapitals Platz zu machen.
Auf die Einsicht der Großkapitalbesitzer zu hoffen, erscheint mir ebenfalls Utopie zu sein.
Letzten Endes führt kein Weg daran vorbei – wir müssen zu einem funktionierenden Wettbewerbsmodell (dem Kern des ordoliberalen Konzepts) zurück. Das setzt einen starken Staat voraus, der diese Prinzipien umsetzen kann, sich aber ansonsten operativ aus dem Wirtschaftsgeschehen heraushält (und auch sonst neutral ist). Das muss gepaart sein mit dem, was Keynes sagte: Vorzug auf regionale Produktion, zwingend mit nationalen Finanzen (Zitat in dem Artikel).
Utopie? Scheint so. Aber geht es anders?