Draghi sagte auf der ersten Pressekonferenz der EZB in diesem Jahr, die Geldpolitik könne nicht viel tun, um die strukturelle Arbeitslosigkeit in der Eurozone zu bekämpfen. Aber es gibt ja "positive Ansteckung"…
Der Anfang Januar erschienene Bericht „Employment and Social Developments in Europe 2012“ analysiert auf fast 500 Seiten Arbeitsmarkt und soziale Lage in der EU. Er kommt zu dem Schluss, dass ein Nachfrageschock die eigentliche Ursache für die prekäre Lage (11,8% Arbeitslosigkeit – siehe Eurozone: Bodenbildung?) von Millionen Arbeitslosen und (nicht mehr) Arbeitssuchenden in Europa ist. Alles andere sei wenig relevant.
Damit widerspricht er letztlich Draghi und dem Brüsseler Glaubensbekenntnis, eine Strukturreform der Arbeitsmärkte in den Krisenländern sei erforderlich, um eine wirtschaftliche Erholung zu bewirken.
Wie lässt sich „strukturelle“ Arbeitslosigkeit statistisch erfassen? „Strukturell“ hat verschiedene Facetten, letztlich läuft es darauf hinaus, dass sie im Unterschied zu „konjunkturell“ zeitlich überdauernd und überdurchschnittlich hoch ist.
Ein Kriterium ist somit die Langzeitarbeitslosigkeit. Das immer wieder als leuchtendes Beispiel für Krisenbewältigung angeführte Irland (IE) liegt mit fast 8,5% in der Spitzengruppe, das EU-Mittel (EU-27) liegt bei 4% der „aktiven Bevölkerung“.
Eine weitere Möglichkeit, den strukturellen Anteil an der Arbeitslosigkeit zu messen, ist die Zahl derer zu erfassen, die zwar bereit und in der Lage sind, zu arbeiten, aber die Suche nach einem Job aufgegeben haben – sei es, weil sie schwarz arbeiten, sei es, weil die Arbeitssuche lange Zeit erfolglos war. Hier führt Italien (IT) die Statistik mit nahezu 12% der aktiven Bevölkerung an. Das EU-Mittel (EU-27) liegt bei 3,8% der „aktiven Bevölkerung“.
Beide Statistiken geben jeweils nur einen Teil der Wahrheit wider. Spanien (ES), Lettland (LV), Ungarn (HU), Estland (EE) und Bulgarien (BG) zeigen nach beiden Ansätzen Werte über dem EU-Durchschnitt. Griechenland (EL) ist nur hinsichtlich Langzeit-Arbeitslosigkeit überdurchschnittlich. Ich vermute, beim zweiten Kriterium schlägt die Unfähigkeit der staatlichen Verwaltung (und/oder der hohe Anteil der Schattenwirtschaft) zu.
Ein dritter Ansatz ist die „Material deprivation“. Die “materielle Entbehrung” bezieht sich auf einen Zustand anhaltender individueller materieller Probleme. Die Definition können Sie hier nachlesen.
Auch hier liegen wie bei den vorigen beiden Ansätzen Bulgarien, Lettland, Ungarn, Estland über dem Mittelwert der EU-27 (~8% der Gesamtbevölkerung). Griechenland taucht ebenfalls auf, auch die Slowakei (SK). Zu beachten ist, dass die Zahlen aus 2011 stammen, als die Eurokrise in Spanien, Italien und Portugal noch nicht voll ausgebrochen war. Mit 2012er Zahlen dürften alle drei in die Spitzengruppe der Kriterien aufrücken und spätestens damit dürfte ihre Arbeitsmarktsituation ebenfalls als „strukturell“ problematisch gelten.
Umgekehrt fällt auf, dass Länder mit besser entwickelten Sozialsystemen (alles ist relativ…) und gleichzeitig flexiblen Arbeitsmärkten zuletzt besser gefahren sind. Der Bericht nennt Deutschland, die nordischen Länder und bis zu einem gewissen Grade auch Großbritannien. Diese Länder liegen allesamt nach den obigen drei Kriterien jeweils im unteren Drittel.
Der Bericht stellt insbesondere die Segmentierung der Arbeitsmärkte in den südlichen Ländern als Problem heraus. Das bezieht sich auf erleichterte Kündigungsmöglichkeiten kürzer Beschäftigter, das Herausnehmen kleinerer Firmen aus bestimmten Vorschriften usw. Das wird auch als entscheidende Ursache für die hohe Jugendarbeitslosigkeit gesehen.
Der Bericht hebt letztlich auf einen Nachfrageschock als Grund für die Arbeitsmarktprobleme in der EU ab. Ich glaube aber, dass wir es mit gewaltigen strukturellen Problemen zu tun haben. Wie sollte das auch anders sein, in einem Staatengebilde, dessen Grundlagen in einer Missachtung einfachster wirtschaftlicher Regeln bestehen (siehe "Eurozone: Von Anfang an daneben")?
Die strukturellen Reformen, die der EU-Kommission vorschweben, zielen darauf ab, das Lohnniveau in den Krisenländern allgemein zu senken. Dabei dürfte den Verantwortlichen das deutsche Vorbild im Kopf herumspuken, das mit „Hartz-4“ einen Niedriglohnsektor ermöglichte. Das war aber zu einer anderen Zeit, im Umfeld einer aufstrebenden Weltkonjunktur und in einer nationalen Wirtschaft, die traditionell stark exportorientiert ist. Unter den heutigen Umständen führt eine solche Politik dazu, dass sich die soziale Situation breiter Bevölkerungsschichten nachhaltig weiter verschlechtert.
Bezeichnenderweise sind gerade unter den Schlusslichtern hinsichtlich Arbeitsmarkt und persönlicher Wohlstandssituation einige Länder, die von der EU-Kommission gerne als Erfolgsgeschichte herausgestellt werden.
Aus Sicht des o.a. Berichts ist es nur folgerichtig, wenn statt Brüsseler Lohndrückerei dafür gesorgt würde, die Nachfrage zu steigern. Dazu gibt es ja gerade in den zurückliegenden Tagen zahlreiche Vorschläge, die im Kern immer darauf hinauslaufen, dass die Kernländer der Eurozone inflationär gesteigerte Nachfrage erzeugen sollen, damit die südliche Peripherie innerhalb des Währungsraums konkurrenzfähiger wird.
Innerhalb eines gemeinsamen Währungsraums ist eine Anpassung durch Wechselkurse nicht möglich. Entweder gehen die Löhne in den Krisenländern herunter oder sie steigen in den Kernländern. Im ersten Fall verschärfen sich bestimmte Aspekte der strukturellen Arbeitslosigkeit in den Krisenländern noch weiter (siehe z.B. Irland, wo die preisliche Anpassung unter den Krisenländern am besten gelungen ist), im zweiten Fall führt Inflation in den Kernländern letztlich dazu, dass die Eurozone insgesamt auf dem Weltmarkt an Wettbewerbsfähigkeit einbüßt.
Viel Spielraum für ein "zwischendrin" ist nicht, denn die Aussichten hinsichtlich Weltkonjunktur sind so rosig gegenwärtig nicht. Darauf hat vor einigen Tagen auch die Weltbank hingewiesen. Sie stutzt ihren 2013er Ausblick deutlich auf 2,4% (von 3,0% im Juni), weil die Erholung in den entwickelten Ländern unerwartet schwach verläuft. Im vergangenen Jahr ist die Weltwirtschaft um 2,3 Prozent gewachsen. Für die Euro-Zone prognostiziert die Weltbank für 2013 ein Schrumpfen des BIPs um 0,1%, USA plus 1,9%, Japan plus 0,8%.
Dass die Arbeitsmärkte darüber hinaus offenbar ein ganz grundsätzliches Problem haben, zeigt der folgende Chart am US-Beispiel.
Demnach braucht der für seine "Flexibilität" bekannte US-Arbeitsmarkt seit dem zweiten Weltkrieg nach jeder Rezession länger, um wieder das Niveau vor der Rezession zu erreichen. Das weist klar darauf hin, dass die wirtschaftlichen Wachtumskräfte offenbar generell erlahmen. Grund genug, hierfür nach strukturellen Ursachen zu suchen – siehe "Wachstumsillusionen | Teil 1"). Mit der geldpolitischen Gießkanne ist da nicht viel auszurichten, erst recht nicht, wenn damit marode Banken geflutet werden.
Das könnte Sie auch interessieren:
- Europas Energie-Armageddon kommt aus Berlin und Brüssel, nicht aus Moskau vom 13.10.2023
- S&P 500 – reicht es jetzt? vom 02.03.2024
- S&P 500 – bullisch, bullischer… vom 02.12.2023


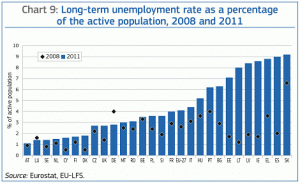
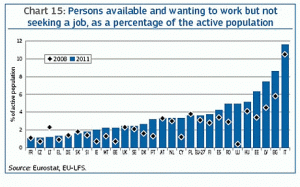
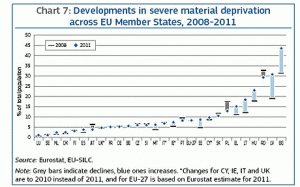
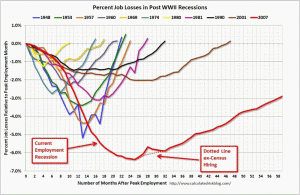

Schreibe einen Kommentar